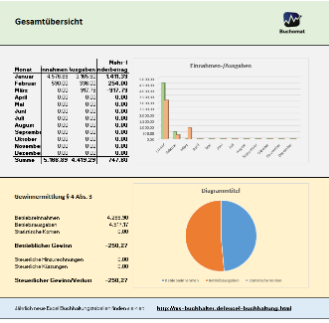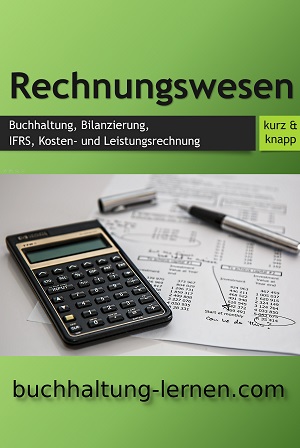Selbstständige in der Rentenversicherung
Wer als Selbständiger pflichtversichert ist
Inhaltsverzeichnis:
Selbstständige in der Rentenversicherung
- ..
- 9.2.1.1 Pflichtbeitragszeiten aufgrund einer versicherten Beschäftigung oder Tätigkeit und einer geringfügig entlohnten Beschäftigung bei Verzicht auf die Versicherungsfreiheit
- 9.2.1.2 Pflichtbeitragszeiten wegen Kindererziehung
- 9.2.1.3 Pflichtbeitragszeiten wegen Wehr- oder Zivildienst
- ..
- ⤺ Zurück zum Inhaltsverzeichnis Selbständige in der Rentenversicherung
9.2.1.2 Pflichtbeitragszeiten wegen Kindererziehung Für Zeiten der Erziehung eines Kindes in Deutschland kann eine sog. Kindererziehungszeit anerkannt werden (§ 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI). Voraussetzung für die Anerkennung dieser Kindererziehungszeit für einen Elternteil (das kann neben den leiblichen Eltern auch ein Adoptiv-, Stief oder Pflegeelternteil oder eine mit dem Kind verwandte oder verschwägerte Person sein) ist, dass • die Erziehungszeit dem Elternteil zuzuordnen ist • die Erziehung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgt bzw. einer solchen gleich steht und • der Elternteil nicht von der Anrechnung der Kindererziehungszeit ausgeschlossen ist. Nicht angerechnet werden Kindererziehungszeiten bei Personen, • die eine Altersvollrente oder eine Altersversorgung nach beamten rechtlichen oder anderen Regelungen erhalten, • die die Regelaltersgrenze bereits erreicht haben und bis dahin nie gesetzlich rentenversichert waren oder • die während der Erziehungszeit Versorgungsanwartschaften im Alter aufgrund der Erziehung in einem anderen Versorgungssystem erworben haben, die dort gleichwertig berücksichtigt werden wie bei der gesetzlichen Rente. Scheidet eine versicherungsfreie oder von der Versicherungspflicht befreite Person ohne Versorgungsanspruch aus dem Beschäftigungsverhältnis aus und wird diese in der gesetzlichen RV nachversichert, kann nachträglich die Versicherungspflicht wegen Kindererziehung ein treten. Nicht ausgeschlossen von der Anrechnung einer Kindererziehungszeit sind • Personen, die nur deswegen versicherungsfrei sind, weil sie - eine geringfügige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit ausüben oder - eine geringfügige nichterwerbsmäßige Pflegetätigkeit ausüben oder - während der Dauer ihres Studiums als ordentliche Studierende einer Fach- oder Hochschule ein Praktikum ableisten, das in ihrer Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschrieben ist und • Personen, die nach übergangsrechtlichen Vorschriften bereits vor Inkrafttreten des RRG 1992 zum 1.1.1992 von der Rentenversicherungspflicht befreit worden sind, z.B. - im Zusammenhang mit der Erhöhung oder dem Wegfall der Jahresarbeitsverdienstgrenze, - wegen einer Beschäftigung beim Ehegatten oder - als Handwerker aufgrund ausreichender Lebensversicherungsverträge. • Umfang und rentenrechtliche Auswirkungen der Kindererziehungszeit Bei Geburten vom 1.1.1992 an ist eine Kindererziehungszeit für die ersten drei Lebensjahre des Kindes zu berücksichtigen. Die Kindererziehungszeit beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der dem Monat der Geburt des Kindesfolgt und dauert längstens 36 Kalendermonate an. Bei Geburten vor dem 1.1.1992 kann eine Kindererziehungszeit anstelle der ersten drei Lebensjahre nur für das erste Lebensjahr des Kindes, also für zwölf Kalendermonate, berücksichtigt werden. Beispiel: Geburt eines Kindes am 4.5.2007. Lösung: Es ist eine Kindererziehungszeit vom 1.6.2007 bis zum 31.5.2010 zu berücksichtigen. Bei zeitgleicher Erziehung mehrerer Kinder verlängert sich die Kindererziehungszeit um die Anzahl an Kalendermonaten, in denen mehrere Kinder gleichzeitig erzogen werden. Beispiel: Geburt von Zwillingen am 19.82004. Lösung: Aufgrund der zeitgleichen Erziehung kann eine Kindererziehungszeit für die Zeit vom 1.9.2004 bis zum 31.8.2010 anerkannt werden. Die maßgebenden Voraussetzungen für die Anerkennung einer Kindererziehungszeit müssen nur in den ersten drei Jahren, nicht je doch in den Verlängerungszeiten, vorliegen. Bei Kindererziehungszeiten handelt es sich um Zeiten der Versicherungspflicht gem. § 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI. Die Beiträge für Kindererziehungszeiten werden vom Bund getragen. Während der Kindererziehungszeit werden Versicherte so gestellt, als würden sie etwa einen Verdienst in Höhe des jeweiligen Durchschnittsentgelts versichern. Im Jahr 2011 entspricht das einem versicherten monatlichen Einkommen von ca. 2522,- EUR bei einer Erziehung in den alten und von ca. 2207,- EUR bei einer solchen in den neuen Bundesländern, ohne dass von dem Versicherten (Erziehenden) hierfür Beiträge geleistet werden müssen. Für zwölf Kalendermonate Kindererziehung ergibt sich in den alten Bundesländern zz. eine monatliche Rentensteigerung von 27,19 EUR. In den neuen Bundesländern sind es 24,12 EUR. Grundsätzlich stehen Kindererziehungszeiten Pflichtbeitragszeiten z.B. wegen einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit gleich. Wird neben der Kindererziehungszeit eine versicherte Beschäftigung oder versicherte selbständige Tätigkeit ausgeübt, wirken sich sowohl die tatsächliche Beitragszahlung als auch die Beitragszahlung für die Kindererziehungszeit „additiv\" rentensteigernd aus. Hierbei kann jedoch höchstens eine Rentensteigerung ermittelt werden, die der Zahlung eines jeweiligen Höchstbeitrages entspricht. Das steht im Jahr 2011 der Versicherung eines monatlichen Entgelts/Einkommens von 5500,-EUR in den alten bzw. 4800-EUR in den neuen Bundesländern gleich. Wer bereits in seiner Beschäftigung ein Arbeitsentgelt in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze versichert, für den wirken sich die vom Bund gezahlten Beiträge für Kindererziehungszeiten folglich nicht aus. Kindererziehungszeiten wirken sich insbesondere wie folgt aus: • sie rechnen mit für die Erfüllung sämtlicher Wartezeiten als Voraussetzung für eine Leistung aus der gesetzlichen RV (vgl. 3); • sie zählen mit für die Erfüllung von versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zur Leistungsgewährung, die in einem bestimmten Rahmenzeitraum eine gewisse Anzahl an (Pflicht-)Beitragszeiten er fordern, also - für die erforderlichen acht Jahre an Pflichtbeitragszeiten vor Beginn einer Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit gem. § 237 SGB VI; - für die mindestens 121 Monate (mehr als zehn Jahre) Pflichtbeitragszeiten nach dem vollendeten 40. Lebensjahrbei einer Altersrente für Frauen gem. § 237a SGB VI; - für die erforderlichen 36 Monate Pflichtbeitragszeiten innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung als Voraussetzung für eine Rente wegen Erwerbsminderung gem. § 43 SGB VI; • sie wirken sich regelmäßig direkt und indirekt rentenerhöhend aus, da sie - als Pflichtbeitragszeit wie alle anderen Beitragszeiten direkt eine Rentenanwartschaft der Höhe nach begründen (wenn die Wartezeit und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Rentenanspruch erfüllt sind), vgl. II.4.2; - im Rahmen der sog. Gesamtleistungsbewertung Einfluss auf die Höhe des für die Bewertung der beitragsfreien Zeiten maßgebenden Gesamtleistungswertes nehmen, vgl. II.5; • als rentenrechtliche Zeit zählen die Kindererziehungszeiten auch zu den für die Prüfung der Mindestentgeltpunkte erforderlichen 35 Jahren mit rentenrechtlichen Zeiten; vgl. II.4.4 und auch für die zur Berücksichtigung zusätzlicher oder gutgeschriebener Entgeltpunkte für Kalendermonate mit Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung oder mit Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines pflege bedürftigen Kindes bis zum vollendeten 18. Lebensjahr u.a. erforderlichen 25 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten, vgl. II .4.5; • bei einer Witwen- oder Witwerrente nach „neuem\" Recht wird die Kindererziehung noch zusätzlich mit einem Zuschlag berücksichtigt, vgl. II.12.1. Auf eine gleichzeitig bestehende Pflichtversicherung kraft Gesetzes von abhängig Beschäftigten oder Selbständigen oder auf eine Antragspflichtversicherung von Selbständigen hat eine Versicherungspflicht wegen Kindererziehung keine Auswirkungen. Für Zeiten der Versicherungspflicht wegen Kindererziehung können jedoch keine zusätzlichen freiwilligen Beiträge gezahlt werden. • Zuordnung der Kindererziehungszeiten/ Übereinstimmende Erklärung Die Kindererziehungszeit ist regelmäßig dem erziehenden Elternteil beziehungsweise bei der gemeinsamen Erziehung eines Kindes durch die Eltern nach dem Tatbestand der überwiegenden Erziehung zuzuordnen. Bei gemeinsamer Erziehung der Mutter und des Vaters kann durch eine übereinstimmende Erklärung die gesamte Kindererziehungszeit oder aber auch nur ein Teil der Kindererziehungszeit dem einen oder anderen Elternteil zugeordnet werden. Die Erziehungszeit kann hierbei beliebig oft zwischen den Elternteilen aufgeteilt werden. Zu beachten ist jedoch, dass eine Erklärung zur Zuordnung der Kindererziehungszeit nur mit Wirkung für die Zukunft abgegeben werden kann. Rückwirkend ist eine Zuordnung längstens für zwei Kalendermonate vor der wirksam abgegebenen Erklärung möglich. Eine einmal abgegebene übereinstimmende Erklärung kann - abgesehen von einer neuen Erklärung mit Wirkung für die Zukunft und bis zu zwei Kalendermonaten in die Vergangenheit - nicht widerrufen werden. Das heißt, die Entscheidung, ob eine Kindererziehungszeit aufgeteilt oder beispielsweise ins gesamt dem Vater zugeordnet werden soll, muss grundsätzlich während der Erziehungszeit (also in den ersten drei Lebensjahren des Kindes) getroffen werden. 1. Beispiel: Geburt eines Kindes am 24.4.2007. Am 15.6.2007 wird beim Rentenversicherungsträger eine überein stimmende Erklärung abgegeben, dass die gesamte Kindererziehungszeit dem Vater zugeordnet werden soll. Es wird keine weitere übereinstimmende Erklärung abgegeben. Lösung: Die Kindererziehungszeit vom 1.5.2007 bis zum 30.4.2010 ist dem Vater zuzuordnen, da eine Zuordnung für bis zu maximal zwei Kalendermonate rückwirkend erfolgen kann. 2. Beispiel: Sachverhalt wie im ersten Beispiel, aber die übereinstimmende Erklärung wird am 24.7.2008 beim Rentenversicherungsträger ab gegeben. Lösung: Da eine übereinstimmende Erklärung nur für maximal zwei Kalendermonate rückwirkend abgegeben werden kann, ist die Kindererziehungszeit wie folgt zuzuordnen: vom 1.5.2007 bis zum 30.4.2008 zur Mutter und vom 1.5.2008 bis zum 30.4.2010 zum Vater. 3. Beispiel: Sachverhalt wie im ersten Beispiel, aber die Erklärung geht erst am 13.5.2010 beim Rentenversicherungsträger ein. Lösung: Da die übereinstimmende Erklärung erst am 13.5.2010 und damit nach Ablauf der Kindererziehungszeit und somit nicht fristgerecht abgegeben wurde, kommt eine Zuordnung der Kindererziehungszeit zum Vater nicht in Betracht. Die gesamte Zeit vom 1.5.2007 bis zum 30.4.2010 ist der Mutter zuzuordnen. Für die Entscheidung, ob und für welche Zeiten eine Kindererziehungszeit dem Vater zugeordnet werden sollte, ist es sinnvoll zu überlegen, für welchen Elternteil es aus rentenrechtlicher Sicht von Vorteil sein kann, die Kindererziehungszeit zugeordnet zubekommen. Hier kann zunächst überlegt werden, ob und ggf. für welche Zeiträume die Kindererziehungszeit sich mit ihrer Wirkung als Pflichtbeitragszeit bei einem Elternteil z.B. zur Erfüllung von Wartezeiten auswirken könnte. Sind beide Elternteile versicherungspflichtig beschäftigt oder selbständig tätig, kann sich unter Umständen die Zuordnung zu dem Elternteil als günstig erweisen, der ein geringeres Entgelt/Einkommen zur RV versichert. Pauschal kann gesagt werden, dass sich eine anrechenbare Kindererziehungszeit in voller Höhe rentensteigernd auswirken wird, wenn neben der Kindererziehungszeit kein Entgelt/Einkommen bzw. ein Entgelt/Einkommen maximal in Höhe der Differenz der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze zum jeweiligen Durchschnittsentgelt zur RV versichert wird. Bei der Versicherung eines höheren Entgelts/Einkommens bis zur maßgebenden Beitragsbemessungsgrenze wird sich die Kindererziehungszeit nicht in voller Höhe bzw. überhaupt nicht mehr eigenständig rentenerhöhend auswirken können. Im Jahr 2011 bedeutet das, dass bis zu einem (einkommensgerecht) versicherten monatlichen Bruttogehalt/-einkommen in den alten Bundesländern von rd. 2978,- EUR und in den neuen Bundesländern von rd. 2593,- EUR eine zeitgleiche Kindererziehungszeit in vollem Umfang rentensteigernd zu berücksichtigen ist. Wird beabsichtigt, die Kindererziehungszeit durch eine gemeinsame Erklärung einem Elternteil zuzuordnen, ist es empfehlenswert, sich hin sichtlich der Auswirkungen der Kindererziehungszeit bei dem einen oder anderen Elternteil rechtzeitig an einen der Rentenversicherungsträger mit der Bitte um entsprechende Aufklärung und Beratung zu wenden. Eine übereinstimmende Erklärung kann bei einem der für die Elternteile zuständigen Versicherungsträger (am besten beim Träger des Elternteils, dem die Kindererziehungszeit zugeordnet werden soll) oder aber auch bei einem unzuständigen Leistungsträger (wie beispielsweise der Krankenkasse oder der Kindergeldkasse der Agentur für Arbeit) abgegeben werden. Weitere Informationen zu dem Thema „Kindererziehungszeiten\" können der Informationsbroschüre der Deutschen Rentenversicherung „Kindererziehung: Ihr Plus für die Rente\" entnommen werden.
Rechtsgrundlagen zum Thema: Rentenversicherung
EStGEStG § 3
EStG § 4d Zuwendungen an Unterstützungskassen
EStG § 8 Einnahmen
EStG § 10
EStG § 10a Zusätzliche Altersvorsorge
EStG § 20
EStG § 22 Arten der sonstigen Einkünfte
EStG § 22a Rentenbezugsmitteilungen an die zentrale Stelle
EStG § 38 Erhebung der Lohnsteuer
EStG § 39b Einbehaltung der Lohnsteuer
EStG § 40a Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte
EStG § 41b Abschluss des Lohnsteuerabzugs
EStG § 42f Lohnsteuer-Außenprüfung
EStG § 49 Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte
EStG § 65 Andere Leistungen für Kinder
EStG § 81 Zentrale Stelle
EStG § 81a Zuständige Stelle
EStG § 86 Mindesteigenbeitrag
EStG § 90 Verfahren
EStG § 91 Datenerhebung und Datenabgleich
EStG § 93 Schädliche Verwendung
EStG § 99 Ermächtigung
EStR
EStR R 4b. Direktversicherung
EStR R 4d. Zuwendungen an Unterstützungskassen
EStR R 6a. (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen
EStR R 16. Veräußerung des gewerblichen Betriebs
EStR R 22.4 Besteuerung von Leibrenten i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG
EStR R 32b. Progressionsvorbehalt
EStR R 33a.1 Aufwendungen für den Unterhalt und eine etwaige Berufsausbildung
EStR R 33b. Pauschbeträge für behinderte Menschen, Hinterbliebene und Pflegepersonen
GewStG
GewStG § 3 Befreiungen
KStG 5
AO
AO § 6 Behörden, Finanzbehörden
AO § 6 Behörden, Finanzbehörden
UStAE
UStAE 4.27.2. Gestellung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften sowie Gestellung von Betriebshelfern
UStAE 4.27.2. Gestellung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften sowie Gestellung von Betriebshelfern
UStR
UStR 121a. Gestellung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften sowie Gestellung von Betriebshelfern und Haushaltshilfen
AEAO
AEAO Zu § 31 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen:
AEAO Zu § 31a Mitteilungen zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leistungsmissbrauchs:
ErbStR 3.5 3.6 5.1 17
ErbStDV muster-2
LStR
R 3.28 LStR Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG)
R 3.62 LStR Zukunftssicherungsleistungen
R 39b.8 LStR Permanenter Lohnsteuer-Jahresausgleich
R 40a.2 LStR Geringfügig entlohnte Beschäftigte
R 40b.1 LStR Pauschalierung der Lohnsteuer bei Beiträgen zu Direktversicherungen und Zuwendungen an Pensionskassen für Versorgungszusagen, die vor dem 1.1.2005 erteilt wurden
R 41a.1 LStR Lohnsteuer-Anmeldung
BewG 12
EStH 4.8 4d.4 6a.14 10.4 10.5 22.3 22.4 32.7 32.9 33.1.33.4 33a.1 33a.3 33b
LStH 3.11 3.62 8.1.1.4 19.1 19.3 39b.6 40.1
BGB 594c 1587
 Steuer-Newsletter
Steuer-Newsletter